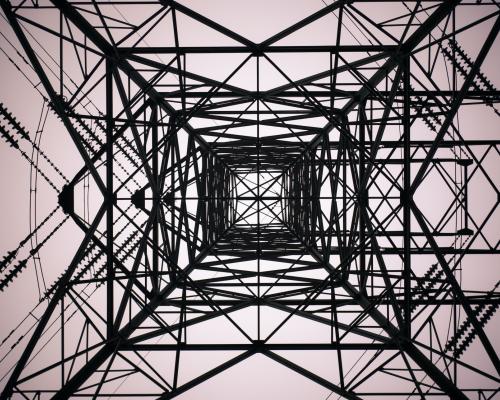Wird es deinen Beruf in Zukunft noch geben?
Eine Tatsache, die nicht von der Hand zu weisen ist: Die Arbeitswelt wandelt sich rasant. Von Ausbildung bis Rente den gleichen Beruf auszuüben, wird immer unwahrscheinlicher.
Denn niemand kann garantieren, dass es deinen Beruf in 10 Jahren noch in dieser Form geben wird. Die weit verbreitete Panikmache, dass wir in absehbarer Zeit massenhaft durch KI ersetzt werden, lässt sich sicherlich kritisch hinterfragen. Gleichwohl werden digitale Technologien die Art, wie wir unsere Aufgaben künftig ausführen, je nach Branche mehr oder weniger verändern.
Und ja, natürlich gibt es auch Berufe, deren Existenz mittelfristig tatsächlich bedroht sein könnte und bei denen fraglich ist, inwieweit eine aktive Beteiligung durch menschliche Arbeitskräfte noch nötig sein wird.
Gleichzeitig stecken darin auch große Chancen, denn das (ohnehin stark zu hinterfragende) “Ideal” der linearen, lückenlosen und glatten Berufsbiographie wird immer weniger relevant. Sich (vielleicht sogar mehrfach) beruflich neu zu definieren, neue Skills zu lernen, neue Tätigkeitsfelder zu erkunden und damit im Laufe der Zeit eine große Bandbreite der eigenen Fähigkeiten und Interessen ausleben zu können, statt sich Jahrzehnte lang in eine Kategorie pressen zu lassen, wird immer normaler. Innerhalb kurzer Zeitspannen entstehen morgen völlig neue Berufe, von denen wir uns heute noch nicht einmal vorstellen können, dass es sie mal geben wird - und die ganz neue Perspektiven eröffnen.
Du suchst nach einem Job mit Sinn?
Du suchst nach einem Job mit Sinn?
Bedrohte vs. krisensichere Tätigkeiten
Spannend fand ich in diesem Zusammenhang einen LinkedIn-Post von Livia Rainsberger. Hier listet die Digitalisierungs-Expertin 40 Berufe auf, die durch KI besonders bedroht sind - und auf der anderen Seite Berufe, die als besonders zukunftssicher gelten. Nicht sonderlich überraschend: Als hochgradig gefährdet gelten Jobs, die größtenteils aus Routinetätigkeiten bestehen und kaum Empathie oder kreative Problemlösung erfordern, z.B. Übersetzer:innen, Telefonist:innen, Service-Verkäufer:innen und Sachbearbeiter:innen. Es sind aber auch zahlreiche akademische, kreative und kommunikationsnahe Berufe dabei, etwa Redakteur:innen (ich sollte mir also wohl ernsthafte Sorgen machen), Schriftsteller:innen, Berater:innen und die noch vor weniger Jahren so gehypten Data Scientists.
Auf der anderen Seite die Tätigkeiten, die als besonders “KI-proof” gelten: Darunter zahlreiche Berufe im medizinisch-pflegerischen Bereich und haufenweise Handwerker:innen. Was krisensichere Berufe also auszeichnet? Empathie, Kreativität, praktische Handlungsfähigkeit vor Ort und ethisches Verantwortungsbewusstsein – Fähigkeiten, in denen der Mensch immer überlegen sein wird.
Genau diese Fähigkeiten führen auch oftmals hin zu Aufgabenfeldern, die einen konkreten gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen, z.B. indem sie auf sozialer Ebene essentielle Funktionen der Daseinsvorsorge sicherstellen oder einen Beitrag zum Ressourcen-, Biodiversitäts- oder Klimaschutz leisten.
12 zukunftssichere Jobs mit gesellschaftlichem und ökologischem Mehrwert
In der folgenden Übersicht stellen wir dir 12 Berufe mit Zukunft vor, die sowohl sinnstiftend als auch weitgehend KI-resistent sind.
1. Pflegefachkraft
Pflegeberufe gelten als besonders zukunftssicher und ihre hohe gesellschaftliche Relevanz ist unbestreitbar. Die demografische Entwicklung sorgt dafür, dass der (ohnehin schon hohe) Bedarf an gut ausgebildeten Pflegefachkräften immer weiter steigen wird. Besonders die Spezialisierung auf Gerontologie (also die Altenpflege) wird daher immer wichtiger.
Pflegefachkräfte sind in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, ambulanten Diensten oder Rehabilitationskliniken tätig und übernehmen dort eine Schlüsselfunktion: Sie sichern die Versorgung von Patient:innen und pflegebedürftigen Menschen und tragen damit entscheidend zur Lebensqualität einer alternden Gesellschaft bei.
Im Arbeitsalltag geht es um die persönliche Betreuung älterer Menschen, die Unterstützung bei der Körperpflege, die Begleitung im Alltag, aber auch um die medizinische Versorgung in Zusammenarbeit mit Ärzt:innen sowie seelsorgerische Zuwendung. Pflegefachkräfte sind nicht nur medizinische Helfer:innen, sondern auch Bezugspersonen, die Sicherheit, Nähe und Orientierung geben.
In diesem Zusammenhang werden auch neue Wohnformen wie Senior:innen-WGs oder Mehrgenerationenhäuser immer relevanter. Dadurch werden auch die Aufgabenfelder der Pflegefachkräfte vielfältiger: Hier geht es nicht mehr nur um die Betreuung einzelner Menschen, sondern darüber hinaus viel um die Förderung sozialer Kontakte innerhalb der Einrichtungen und die individuelle Förderung der Klient:innen, damit sie möglichst selbstständig ihren Alltag bewältigen können.
Seit 2020 gibt es in Deutschland die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann. Diese vereinheitlicht die vorher getrennten Ausbildungen in Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege und dauert drei Jahre.
Warum KI diesem Beruf wenig anhaben kann
KI kann beispielsweise beim “Papierkram”, etwa bei der Auswertung von Patientendaten und Diagnostik unterstützen oder Verwaltungsaufgaben übernehmen, so dass Pflegefachkräfte mehr Zeit für die direkte Betreuung haben. Doch Empathie, Berührung, Zuhören und das zwischenmenschliche Gespür einer Pflegekraft sind nicht ersetzbar.
2. Pädagog:in / Erzieher:in
Im Bildungs- und Erziehungsbereich ist die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften ungebrochen.
Erzieher:innen begleiten Kinder in Kindertagesstätten, Horten oder anderen pädagogischen Einrichtungen durch ihre Entwicklungsphasen. Sie gestalten den Alltag der Kinder, fördern soziale Kompetenzen, motorische und kognitive Fähigkeiten und kreativen Ausdruck.
Während Erzieher:in ein klar definierter Ausbildungsberuf ist, beschreibt der Begriff Pädagogik ein breit gefächertes Berufsfeld, innerhalb dessen zahlreiche Spezialisierungen möglich sind. Pädagog:innen haben in der Regel ein Studium der Erziehungswissenschaften, Bildungswissenschaften, Sozialpädagogik, Heilpädagogik o.Ä. absolviert. Ihr Einsatzgebiet kann ebenfalls in Kitas oder Schulen liegen, darüber hinaus aber auch in der Erwachsenenbildung, in der Forschung, in Behörden, der Sozialarbeit oder in der Entwicklung von Bildungsprogrammen. Die Arbeit kann sehr praktisch orientiert sein, z.B. in der unmittelbaren Begleitung von Kindern mit Migrationsbiografie oder von Menschen mit Behinderungen. In anderen Einsatzfeldern geht es eher um theoretische Fragen von Bildung und Erziehung, sie analysieren Strukturen und Konzepte und entwickeln neue Ansätze, die dann in der Praxis angewendet werden.
Warum KI diesen Berufen wenig anhaben kann
Künstliche Intelligenz wird im pädagogischen Bereich zwar unterstützend wirken, etwa durch digitale Lernprogramme oder Tools zur Dokumentation. Doch die eigentliche Kernaufgabe des Berufs – Menschen Geborgenheit zu geben, Werte zu vermitteln und sie im direkten Kontakt zu fördern – ist durch Maschinen nicht ersetzbar. Gerade in einer zunehmend digitalisierten Welt wird die Rolle von pädagogischen Fachkräften als stabile Bezugspersonen sogar noch wichtiger.

3. Fachkräfte im Bereich Erneuerbare Energien
Eine Abkehr von fossilen Energien wird unvermeidbar, wenn menschliches Leben auf diesem Planeten langfristig möglich bleiben soll.
Gestalter:innen der Energiewende werden daher auf mehreren Ebenen benötigt: Einerseits Ingenieur:innen, die neue technologische Lösungen für Solaranlagen, Windkraftwerke, Energienetzwerke und innovative Energiespeicher entwickeln. Sie fungieren als Innovationstreiber:innen und arbeiten an der Schnittstelle von Forschung, Technik und Praxis. Passende Studiengänge sind z.B. Maschinenbau, Umwelttechnik, Elektrotechnik oder Energietechnik.
Andererseits braucht es mindestens genauso dringend Macher:innen, die diese Technologien auf der praktischen Ebene installieren, umsetzen und am Laufen halten. Sprich zum Beispiel:
- Solartechniker:innen, die Solaranlagen auf die Dächer bringen,
- Anlagenmechaniker:innen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), die moderne Heizsysteme mit hoher Energieeffizienz wie z.B. Wärmepumpen, Solarthermieanlagen oder Biomassekessel installieren,
- entsprechend spezialisierte Elektroniker:innen, die Gebäude mit energieeffizienter Technik für Licht, Heizung oder Lüftung ausstatten,
Besonders der handwerkliche Sektor bietet hervorragende Zukunftsaussichten, denn der Fachkräftemangel gerade in technischen Ausbildungsberufen ist eklatant.
Eine ausführliche Vorstellung weiterer nachhaltiger Berufe im Handwerk sowie 10 weitere Berufe für die Energiewende findest du hier.
Warum KI diesen Berufen wenig anhaben kann
Insbesondere Ingenieur:innen werden künftig immer mehr mit KI und anderen digitalen Technologien zu tun haben. Diese können z.B. helfen, Berechnungen und Simulationen zu optimieren, gleichzeitig aber benötigen die kreative Entwicklung neuer Systeme und die Koordination komplexer Projekte weiterhin menschliche Köpfe.
Auch der Arbeitsalltag von Handwerker:innen wird immer digitaler, z.B. mit Tools für Fehlerdiagnose, Fernwartung oder zur Planung komplexer Anlagen. Die eigentliche handwerkliche Arbeit jedoch kann keine Maschine übernehmen - dafür werden weiterhin geschickte Hände, menschliche Expertise und Tatkraft gebraucht.
4. Landwirt:in mit ökologischem Schwerpunkt
Biobetriebe boomen, und die Nachfrage nach regionalen, nachhaltigen Lebensmitteln steigt stetig. Neben der Energiewende gehören die Agrar- und Ernährungswende zu den drängendsten Handlungsfeldern unserer Zeit. Die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen, nämlich gesunder Böden und der Artenvielfalt, erfordert eine zukunftsfähige Art der Landwirtschaft, die von regenerativen Praktiken statt der massenhaften Nutzung chemisch-synthetischer Pflanzenschutz- und Düngemittel und Massentierhaltung geprägt ist.
Der Alltag von Landwirt:innen im Ökolandbau ist von festen Routinen geprägt und reicht von der Anbauplanung über die praktische Feldarbeit und Pflanzenpflege, Tierhaltung bis zur Organisation des Hofbetriebs. Die Arbeit ist sehr körperlich und erfordert auf dieser Ebene daher eine entsprechende Belastbarkeit sowie eine Affinität für das Führen von schweren Maschinen.
Die Grundlage für den Einstieg bilden eine landwirtschaftliche Ausbildung (Landwirt:in oder Tierwirt:in) oder - vor allem dann, wenn eine Tätigkeit Richtung Management und die wirtschaftliche Steuerung von Agrarbetrieben angestrebt wird - ein Agrarstudium.
Warum KI diesem Beruf wenig anhaben kann
Digitale Technologien werden künftig auch den eher traditionell geprägten Ökolandbau zunehmend verändern. Dies ist unvermeidlich, wenn die Branche langfristig in Punkto Effizienz zur konventionellen Landwirtschaft konkurrenzfähig bleiben will. So können Landwirt:innen mit präziser Datenerfassung Felder punktgenau bewirtschaften: Sensoren messen etwa die Bodenfeuchtigkeit, Drohnen erkennen Krankheitsbefall oder Schädlingsdruck frühzeitig. Statt großflächig zu behandeln, können ökologische Maßnahmen gezielt eingesetzt werden, z.B. mechanische Unkrautbekämpfung oder punktuelles Ausbringen von Nützlingen. Auch die automatisierte Unkrautbekämpfung, z.B. mit KI-gesteuerten Hackrobotern oder Maschinen mit Kamerasystemen, die Unkraut von Kulturpflanzen unterscheiden können, spart Arbeitszeit und ermöglicht eine schonendere Bearbeitung der Böden.
Dennoch bleiben menschliche Fähigkeiten an mehreren entscheidenden Punkten unverzichtbar: Digitale Systeme liefern Daten, doch die Entscheidung, wie damit umzugehen ist, bleibt menschlich. Zum Beispiel kann ein Sensor melden, dass der Boden zu trocken ist – aber die Entscheidung, ob gegossen wird, hängt von ökologischen Überlegungen ab: Soll man das Grundwasser schonen? Ist eine andere Kultur wichtiger? Solche ethischen und ökologischen Abwägungen sind nicht in Algorithmen nur schwer abbildbar. Zudem spielt gerade im Ökolandbau der direkte Kontakt zu Verbraucher:innen eine große Rolle. Viele Betriebe setzen auf Hofläden, Märkte oder Bildungsangebote. Diese Beziehungsarbeit, das Erzählen von Geschichten über Herkunft und Anbau, kann keine KI ersetzen. Sie schafft Vertrauen und Authentizität.
5. Klimaschutzmanager:in / Nachhaltigkeitsmanager:in
Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanager:innen sind Schnittstellenpersonen mit breitem Fachwissen, die innerhalb ihres Wirkungsbereiches im engen Austausch mit unterschiedlichen Interessengruppen (Stakeholdern) stehen. Die Bezeichnung “Klimaschutzmanager:in” ist eher im öffentlichen Dienst bzw. im kommunalen Bereich zu finden, wohingegen der Jobtitel “Nachhaltigkeitsmanager:in” eher im wirtschaftlich-unternehmerischen Kontext üblich ist (wobei es keine wirklich trennscharfe Abgrenzung gibt).
Egal ob Kommune oder Unternehmen: Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Entwicklung und Umsetzungsbegleitung maßgeschneiderter und wirkungsvoller Maßnahmen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Dies umfasst u.a. die Erstellung von CO2-Bilanzen, die Erarbeitung von Klimaschutzkonzepten oder Nachhaltigkeitsberichten sowie die Durchführung von Beteiligungsformaten (z.B. Befragungen, Workshops, Trainings) für Stakeholdergruppen. Auch die Beratung von Entscheidungsträger:innen (je nach Kontext politischer Akteure oder Führungskräfte von Unternehmen) sowie Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Nachhaltigkeitskommunikation fallen oftmals in den Aufgabenbereich.
Der Einstieg kann über unterschiedliche Studiengänge erfolgen. Im (kommunalen) Klimaschutzmanagement sind dies üblicherweise z.B. Stadt- und Raumplanung, Geografie oder Umweltwissenschaften. Der Weg ins (unternehmerische) Nachhaltigkeitsmanagement erfolgt oft über Studiengänge mit wirtschaftlichen Schwerpunkt, Umwelttechnik- & Ressourcenmanagement oder spezialisierte Nachhaltigkeits-Studiengänge.
Warum KI diesen Berufen wenig anhaben kann
Klimaschutzmanager:innen arbeiten an der Schnittstelle zwischen Unternehmen, Verwaltung, Politik und Gesellschaft. KI kann zwar nachhaltigkeitsrelevante Kennzahlen & Daten analysieren, Szenarien berechnen, Energieverbräuche optimieren sowie das Nachhaltigkeitsreporting vereinfachen.
Doch Nachhaltigkeit ist kein rein technisches Thema, sondern stark geprägt von Werten und Verantwortung. Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanager:innen verhandeln mit verschiedenen Interessengruppen, moderieren Prozesse und bauen Netzwerke auf.
Sie übersetzen wissenschaftliche Erkenntnisse in Handlungsstrategien, die gesellschaftlich akzeptiert sind. Sie müssen mit diplomatischem Geschick Bürger:innen, Mitarbeitende oder Entscheidungsträger überzeugen – und Vertrauen aufbauen. Vertrauen entsteht jedoch durch Empathie, Glaubwürdigkeit und menschliche Präsenz, nicht durch KI-Systeme.
Auch die Entwicklung einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie, die ökologische, soziale, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte verbindet, erfordert menschliches Urteilsvermögen. Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanager:innen müssen Zielkonflikte abwägen, z. B. wenn Maßnahmen ökologisch sinnvoll, aber finanziell schwer umsetzbar sind oder soziale Ungerechtigkeiten verstärken. Diese politische und gesellschaftliche Kontextsensibilität kann KI nicht in gleicher Weise leisten.
Weitere ausführliche Informationen findest du in unseren Job Portraits für Nachhaltigkeitsmanagement und kommunales Klimaschutzmanagement.

6. Psychotherapeut:in / psychologische:r Berater:in
Psychische Erkrankungen wie Burnout, Depressionen, Angsterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen sind in unserer leistungsgetriebenen und gleichzeitig krisengeschüttelten Gesellschaft zunehmend auf dem Vormarsch. Zudem führt die (glücklicherweise) zunehmende Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen dazu, dass auch der Bedarf nach Therapie- und Beratungsangeboten regelrecht explodiert. Auf der anderen Seite gibt es zu wenige Therapeut:innen: Für einen Therapieplatz 9 bis 12 Monate Wartezeit in Kauf nehmen zu müssen, ist leider keine Seltenheit mehr. Hier eröffnet sich also definitiv ein Berufsfeld mit sehr guten Perspektiven.
Psychotherapeut:in
Psychotherapeut:innen treffen Diagnosen, begleiten Menschen durch Krisen und wenden je nach Erkrankungsbild unterschiedliche therapeutische Verfahren, z.B. Verhaltenstherapie, Psychoanalyse oder systemische Therapie, an. Der Arbeitsalltag ist geprägt von intensiven Gesprächen, dem Aufbau von zwischenmenschlichem Vertrauen und dem Erarbeiten von Strategien zur Bewältigung von Problemen.
Der Einstieg erfolgt über ein abgeschlossenes Psychologie- oder Medizinstudium und anschließend eine mehrjährige staatlich geregelte Weiterbildung in Psychotherapie. Seit 2020 gibt es zudem den neuen Studiengang Psychotherapie, der direkt auf diesen Beruf hinführt.
Psychologische:r Berater:in
Die Hürden für ein Psychologie- oder Medizinstudium sind bekanntermaßen enorm (hoher NC, hoher zeitlicher Aufwand, hohe Kosten für die Weiterbildung). Eine weitere Option kann daher eine Ausbildung zum/zur Psychologische:n Berater:in darstellen. Psychologische Beratung richtet sich meist an Menschen in Lebenskrisen, Konflikten oder Entscheidungsphasen. Ziel ist Unterstützung, Orientierung und Stärkung der persönlichen Ressourcen. Es geht nicht um die Diagnose und Behandlung von psychischen Erkrankungen, sondern um beratende Gespräche. Zielgruppen können Einzelpersonen, Paare oder Familien sein. Oft liegt der Fokus auf Themen wie Stressbewältigung, Burnout-Prävention, Partnerschaftskonflikte, berufliche Orientierung oder Persönlichkeitsentwicklung.
Der Einstieg erfolgt über private Weiterbildungen oder Zertifikatskurse, die jedoch nicht staatlich reguliert sind und stark in Qualität und Tiefe variieren können. Informiere dich daher im Vorfeld gut über das Weiterbildungsinstitut und die vermittelten Inhalte.
Warum KI diesen Berufen wenig anhaben kann
Es gibt bereits einige Mental Health Apps und KI-basierte Tools, die bei psychischen Erkrankungen und Belastungssituationen unterstützen. Die Online-Therapieprogramme der App "Selfapy" werden sogar bereits von Krankenkassen übernommen. Das Tool "Woebot" bietet einen KI-Chatbot, mit dem Betroffene in einer Art simuliertem Therapiegespräch einen Dialog führen können.
Diese Angebote können sehr hilfreich sein, um kurzfristig zu entlasten, Wartezeiten zu überbrücken oder im Rahmen einer bestehenden Therapie zusätzlich zu unterstützen. Eine tragfähige und authentische Beziehung, wie sie zwischen Klient:in und Therapeut:in aufgebaut wird, können sie jedoch nicht ersetzen. Für einen nachhaltigen Heilungsprozess sind menschliche Wärme, Mitgefühl und Feinfühligkeit unverzichtbar. Psychotherapeut:innen hören nicht nur auf Worte, sondern nehmen auch Stimmungen, Zwischentöne, Körpersprache, Pausen und Emotionen wahr. Sie reagieren flexibel und intuitiv – manchmal auch entgegen dem, was „logisch“ erscheint. Diese intuitive Feinfühligkeit kann KI nicht in derselben Tiefe abbilden, weil sie auf Datenmustern, nicht auf gelebter Erfahrung beruht.
7. Sozialarbeiter:in
Sozialarbeiter:innen begleiten Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen stecken. Je nach Tätigkeitsschwerpunkt können dies Kinder und Jugendliche, Familien oder Menschen mit Suchterkrankungen oder anderen psychischen Belastungen sein. Sie arbeiten z.B. in Beratungsstellen, Wohnheimen, Schulen, Unterkünften für Geflüchtete oder besuchen die Klient:innen regelmäßig zu Hause und begleiten sie bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben.
Neue Berufsfelder wie “Digital Streetworker:in” nutzen digitale Technologien, um Menschen dort zu erreichen, wo sie sich heutzutage viel aufhalten: Im Internet. Während klassische Streetworker:innen auf der Straße, in Parks oder Jugendzentren präsent sind, sind Digital Streetworker:innen in sozialen Netzwerken, Gaming-Communities, Foren oder Messenger-Diensten aktiv. Ihre Aufgabe ist es, Kontakt zu gefährdeten oder isolierten Menschen aufzubauen, die online nach Orientierung, Gemeinschaft oder Hilfe suchen. Sie bieten niedrigschwellige Beratung, vermitteln bei Konflikten, klären über Risiken wie Cybermobbing, Extremismus oder Sucht auf und lotsen Betroffene bei Bedarf in weiterführende Hilfsangebote wie Beratungsstellen oder Jugendämter.
Voraussetzung für den Einstieg ist in aller Regel ein Studium der Sozialen Arbeit oder ein verwandter Studiengang.
Warum KI diesem Beruf wenig anhaben kann
Der Kern dieser Tätigkeit – egal ob analog oder online – ist Beziehungsarbeit: Vertrauen aufbauen, Verlässlichkeit zeigen und in Krisen präsent sein. Sozialarbeiter:innen müssen zudem spontan entscheiden, deeskalieren, improvisieren. Solche Entscheidungen sind nicht nur rational, sondern beruhen auf Erfahrung, Intuition und moralischem Urteilsvermögen. Dieses wird ebenfalls im Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle benötigt, etwa im Kinderschutz, bei Suchtprävention oder Resozialisierung. Ob man eingreifen, eine Familie melden oder Freiräume lassen sollte, ist eine ethisch hochsensible Entscheidung, die nicht an Algorithmen delegiert werden kann.
Gleichwohl kann KI Sozialarbeiter:innen in Zukunft unterstützen, etwa durch digitale Dokumentation, schnellen Zugang zu Hilfsnetzwerken oder Risikoanalysen – doch das emotionale und soziale Verständnis im direkten Kontakt bleibt ein menschliches Privileg.
Entdecke hier eine ausführliche Vorstellung des Berufes Soziale Arbeit sowie 10 soziale Berufe, die du wahrscheinlich noch nicht kennst.

8. Forstwirt:in
Dieser Beruf zählt zu den traditionsreichsten grünen Berufen überhaupt – und zugleich zu jenen, die im Zuge des Klimawandels eine völlig neue Bedeutung und Dynamik erhalten haben. Während die Arbeit früher stark auf die reine Holzproduktion ausgerichtet war, geht es heute zunehmend darum, Wälder als vielschichtige Ökosysteme und Klimaschützer zu bewahren und zukunftsfähig zu machen.
Forstwirt:innen arbeiten überwiegend draußen im Wald, oft in Teams, und kümmern sich um die Pflege, Erhaltung und Nutzung von Wäldern. Der klassische Alltag umfasst das Pflanzen von Bäumen, die Pflege von Jungbeständen, das Durchführen von Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiss oder Schädlinge, die Holzentnahme sowie die Instandhaltung von Waldwegen und Schutzanlagen. Hinzu kommt der Einsatz von Maschinen wie Harvester oder Rückezüge, die eine effiziente Holzernte ermöglichen.
Doch der Arbeitsalltag hat sich verändert: Heute beschäftigen sich Forstwirt:innen stärker mit klimastabilen Mischwäldern, also mit der gezielten Pflanzung unterschiedlicher Baumarten, die besser an Hitze und Trockenheit angepasst sind. Statt großflächiger Fichtenmonokulturen liegt der Fokus zunehmend auf Diversität: Unterschiedliche Baumarten werden bewusst kombiniert, um Wälder robuster gegen Schädlinge, Trockenheit und Stürme zu machen. Auch die Schutzfunktionen des Waldes rücken stärker in den Mittelpunkt. Wälder sind nicht nur Holzlieferanten, sondern auch CO₂-Speicher, Wasserspeicher, Lebensraum für Artenvielfalt und ein Erholungsraum für Menschen. Forstwirt:innen sorgen dafür, dass diese Funktionen langfristig erhalten bleiben – ein komplexes Gleichgewicht zwischen ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher Nutzung.
Der Beruf wird in einer dreijährigen dualen Ausbildung erlernt. Aufbauend auf die Ausbildung können Forstwirt:innen Weiterbildungen zum/zur Forsttechniker:in, Forstwirtschaftsmeister:in oder Waldpädagog:in absolvieren. Auch ein anschließendes Studium in Forstwissenschaft oder Waldökologie ist möglich.
Entdecke hier eine Übersicht zu 10 nachhaltigen Ausbildungsberufen sowie Berufen, mit denen du überwiegend draußen an der frischen Luft arbeiten kannst.
Warum KI diesem Beruf wenig anhaben kann
Mit zunehmender Digitalisierung gewinnen zwar auch Kenntnisse im Umgang mit Geoinformationssystemen (GIS-Systemen), Drohnen zur Waldschadenskartierung, Sensoren für Bodenfeuchtigkeit oder digitalen Forstmanagement-Programmen an Bedeutung. Doch die praktische Arbeit im Wald, sprich das Pflanzen, Pflegen, Schützen und Ernten von Bäumen – bleibt auch künftig ein zutiefst handwerklicher Beruf, der menschliche Kraft, Geschick und Erfahrung benötigt.
9. Hebamme
Mehr Zukunftssicherheit geht kaum, denn Hebammen werden immer gebraucht. Sie begleiten werdende Mütter und Familien während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Auch wenn sich die medizinischen Rahmenbedingungen stark gewandelt haben, bleibt ihre Arbeit unverzichtbar – nicht nur aus fachlicher, sondern auch aus menschlicher Sicht.
Denn die Arbeit von Hebammen ist weit mehr als medizinische Dienstleistung. Sie hat eine tiefe gesellschaftliche Dimension: Hebammen begleiten Familien an einem der wichtigsten Wendepunkte des Lebens. Sie tragen zur Gesundheit von Mutter und Kind, zur Prävention von Komplikationen und zum psychischen Wohlbefinden bei.
In einer Gesellschaft, in der Stress, Einsamkeit und Überforderung während der Schwangerschaft oder nach der Geburt eine große Herausforderung darstellen können, sind Hebammen eine verlässliche Stütze. Ihre Arbeit hat auch langfristige Effekte: Eine gute Betreuung in den ersten Lebensmonaten wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Kindes und die psychische Stabilität der Eltern aus. Damit leisten Hebammen einen direkten Beitrag zur Gesundheitsvorsorge und zur Stärkung von Familienstrukturen – ein Aspekt, der angesichts sinkender Geburtenzahlen und wachsender gesellschaftlicher Belastungen hochrelevant ist.
Seit 2020 erfolgt die Ausbildung zur Hebamme in Deutschland über ein primärqualifizierendes Studium an Hochschulen. Dieses dauert in der Regel sieben bis acht Semester und schließt mit einem Bachelorabschluss ab. Nach dem Studium sind Weiterbildungen möglich, etwa in den Bereichen Still- und Laktationsberatung, Familienbegleitung, Schmerztherapie oder Leitung von Kreißsälen. Auch ein Masterstudium in Hebammenwissenschaft oder Public Health kann angeschlossen werden.
Warum KI diesem Beruf wenig anhaben kann
Digitale Technologien halten auch in der Geburtshilfe Einzug, etwa durch Telemedizin, digitale Dokumentation oder Apps für Schwangerschaftsbegleitung. Künstliche Intelligenz kann unterstützen, indem sie Vitaldaten analysiert oder Risikoindikatoren erkennt. Doch Hebammenarbeit ist ein Beruf, der stark auf zwischenmenschlicher Nähe, Vertrauen und Intuition basiert.
Maschinen können zwar Messwerte liefern, aber sie ersetzen nicht das beruhigende Gespräch, die einfühlsame Begleitung in der Geburt oder die sensible Einschätzung einer Mutter-Kind-Bindung. Gerade die emotionale und körperliche Nähe, die Fähigkeit, individuelle Bedürfnisse zu erkennen und Vertrauen aufzubauen, machen Hebammen unersetzlich.

10. Stadtplaner:in für nachhaltige Quartiere
Der Beruf Stadtplaner:in ist ein Schlüsselberuf für die Gestaltung nachhaltiger, lebenswerter und widerstandsfähiger Städte. Während urbane Räume weltweit wachsen und sich gleichzeitig den Folgen des Klimawandels, der Digitalisierung und dem demografischen Wandel stellen müssen, gewinnen Stadtplaner:innen zunehmend an Bedeutung. Sie entwickeln Konzepte für klimafreundliche Mobilität, für den Ausbau erneuerbarer Energien in urbanen Räumen, für den Schutz vor Hitzeinseln durch mehr Grünflächen oder für die Anpassung an Starkregenereignisse. Darüber hinaus sorgen sie für soziale Gerechtigkeit im Stadtraum: Indem sie bezahlbaren Wohnraum fördern, barrierefreie Zugänge schaffen oder Quartiere so gestalten, dass Begegnung und Integration möglich werden, leisten sie einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Stadtplaner:innen arbeiten somit an den Schnittstellen von Architektur, Geografie, Verkehrs- und Umweltplanung, Politik und Gesellschaft und prägen maßgeblich die Orte, in denen Menschen leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen.
Ein typischer Arbeitsalltag umfasst daher sowohl Büroarbeit (z.B. Erstellen von Plänen, Gutachten oder digitalen Simulationen) als auch öffentliche Präsentationen und Bürgerbeteiligungsprozesse. Stadtplaner:innen moderieren Workshops, organisieren Infoveranstaltungen und beziehen die Bevölkerung in die Planungsprozesse ein.
Um Stadtplaner:in zu werden, ist in der Regel ein Studium der Stadt- und Regionalplanung, Raumplanung oder Architektur erforderlich. Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es in Spezialfeldern wie Verkehrsplanung, Klimaanpassung, Bürgerbeteiligung oder digitale Stadtentwicklung (Smart Cities).
Warum KI diesem Beruf wenig anhaben kann
Die Stadtplanung verändert sich durch den Einsatz neuer Technologien massiv. Digitale Simulationen, Geoinformationssysteme (GIS) und KI-gestützte Prognosen helfen Stadtplaner:innen, Szenarien zu modellieren: Wie verändert sich das Stadtklima, wenn eine Straße begrünt wird? Welche Verkehrsflüsse entstehen durch eine neue Tramlinie? Welche Flächen sind bei Starkregen besonders gefährdet?
Doch trotz dieser technologischen Unterstützung bleibt die menschliche Expertise unersetzlich. Stadtplanung ist immer auch ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, bei dem Interessen von Politik, Wirtschaft, Bürger:innen und Umwelt in Einklang gebracht werden müssen. KI kann Daten analysieren, aber sie kann nicht soziale Spannungen moderieren, Vertrauen schaffen oder kreative, ortsspezifische Lösungen entwickeln. Stadtplaner:innen bleiben daher zentrale Gestalter:innen, die Technik nutzen, aber durch ihre sozialen, kommunikativen und kreativen Fähigkeiten unverzichtbar sind.
Einen ausführlichen Einblick erhältst du in unserem Job Portrait nachhaltige Stadtplanung.
11. Entwicklungshelfer:in
Fachkräfte im Entwicklungsdienst arbeiten in internationalen Projekten, die das Ziel verfolgen, die Lebensbedingungen in Ländern des Globalen Südens zu verbessern und gleichzeitig Strukturen für eine nachhaltige Entwicklung aufzubauen. Sie sind vor allem in Regionen tätig, die mit Armut, gewaltsamen Konflikten, schwachen Institutionen oder den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben. Dabei stehen nicht kurzfristige Hilfsmaßnahmen im Vordergrund, sondern langfristige Veränderungen, die Menschen vor Ort in die Lage versetzen, ihre Lebensrealität eigenständig zu verbessern.
Die gesellschaftliche Relevanz von Entwicklungshelfer:innen ist enorm. Sie tragen dazu bei, globale Ungleichheiten abzubauen und die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der Vereinten Nationen zu verwirklichen. Indem sie Wissen teilen, Strukturen aufbauen und Menschen befähigen, leisten sie nicht nur einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität vor Ort, sondern auch zur globalen Stabilität.
In einer vernetzten Welt wirkt Entwicklungsarbeit zudem präventiv gegen globale Krisen: Sie hilft, Konflikte einzudämmen, Migration aus Not zu verringern und den Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen. Entwicklungshelfer:innen sind daher nicht nur Fachkräfte für den direkten Einsatz, sondern auch Brückenbauer:innen zwischen Kulturen und Gesellschaften.
Entwicklungshelfer:innen übernehmen eine Vielzahl von Aufgaben, die sich je nach Einsatzland, Organisation und Projekt stark unterscheiden. Ihre Einsatzbereiche umfassen u.a. Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft und Ernährungssicherung, Wasser- und Sanitärversorgung, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Friedensarbeit oder Katastrophenvorsorge.
Um Entwicklungshelfer:in zu werden, ist in der Regel ein abgeschlossenes Studium oder eine qualifizierte Berufsausbildung notwendig. Besonders gefragt sind Fachrichtungen wie Agrarwissenschaften, Ingenieurwesen, Medizin, Pädagogik, Sozialarbeit, Umwelt- und Naturwissenschaften oder Wirtschaft. Neben der fachlichen Qualifikation sind praktische Auslandserfahrungen, Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen von großer Bedeutung.
Warum KI diesem Beruf wenig anhaben kann
Digitale Technologien und auch KI verändern zunehmend die Entwicklungszusammenarbeit. Satellitendaten und KI-gestützte Modelle helfen, Ernteausfälle vorherzusagen, den Zugang zu Wasserquellen zu verbessern oder Klimarisiken zu bewerten. Digitale Plattformen ermöglichen eine bessere Vernetzung und eine effektivere Projektsteuerung.
Dennoch bleiben menschliche Fähigkeiten unersetzlich. Entwicklungshelfer:innen müssen Vertrauen aufbauen, lokale Bedürfnisse verstehen und kulturelle Barrieren überwinden. KI kann Daten liefern, aber sie kann keine persönlichen Beziehungen gestalten oder nachhaltige Lernprozesse begleiten. Deshalb wird der Beruf auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.
Wenn du mehr über Einsatzmöglichkeiten in der Entwicklungszusammenarbeit erfahren möchtest, schau mal in unsere Job Portraits “Friedensarbeit und Konflikttransformation”, “Fachkraft im Entwicklungsdienst” sowie unseren Artikel “10 typische Berufsfelder in der Entwicklungszusammenarbeit”.

12. Ethikberater:in im Gesundheitswesen
Der Beruf Ethikberater:in ist noch vergleichsweise jung, gewinnt aber durch die zunehmende Komplexität medizinischer Entscheidungen stetig an Bedeutung. Ethikberater:innen unterstützen Ärzt:innen, Pflegekräfte, Patient:innen und Angehörige bei schwierigen Fragen, die nicht allein durch medizinisches Wissen oder rechtliche Rahmenbedingungen beantwortet werden können. Sie bewegen sich damit an der Schnittstelle von Medizin, Philosophie, Recht und Gesellschaft – und tragen entscheidend dazu bei, dass Entscheidungen im Gesundheitswesen nicht nur fachlich, sondern auch menschlich verantwortungsvoll getroffen werden.
Ethikberater:innen werden immer dann hinzugezogen, wenn medizinische Entscheidungen mit moralischen Dilemmata verbunden sind. Ein klassisches Beispiel ist die Frage, ob eine lebenserhaltende Maßnahme bei schwerstkranken Patient:innen fortgeführt oder beendet werden soll. Auch bei Themen wie Organtransplantationen, Pränataldiagnostik, assistiertem Sterben, Umgang mit Demenzkranken oder Ressourcenzuteilung in Krisenzeiten (z. B. Intensivbetten während einer Pandemie) werden sie beratend tätig.
Ihr Arbeitsalltag besteht oft aus der Moderation von Ethik-Konsilen – also Gesprächsrunden, in denen Ärzt:innen, Pflegekräfte, Patient:innen und Angehörige gemeinsam eine Entscheidung vorbereiten. Neben der Fallberatung arbeiten sie auch an institutionellen Leitlinien mit, schulen medizinisches Personal in ethischen Fragen und fördern eine offene Gesprächskultur in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Viele sind zudem in Forschung und Lehre tätig und tragen so dazu bei, ethische Standards im Gesundheitswesen langfristig zu verankern.
Ethikberater:in ist kein klassisch geregelter Ausbildungsberuf, sondern setzt auf interdisziplinäre Qualifikationen. Die meisten Fachkräfte verfügen über ein Studium in Medizin, Pflegewissenschaft, Philosophie, Theologie, Psychologie oder Rechtswissenschaft. Darauf aufbauend absolvieren sie eine Weiterbildung in klinischer Ethikberatung, die von Fachgesellschaften und Hochschulen angeboten wird.
Warum KI diesem Beruf wenig anhaben kann
Die Digitalisierung bringt auch für die Ethikberatung neue Fragen mit sich. KI kann helfen, medizinische Daten zu analysieren, Wahrscheinlichkeiten von Krankheitsverläufen zu berechnen oder Entscheidungshilfen zu bieten. Doch genau hier beginnt die ethische Herausforderung: Wer trägt die Verantwortung, wenn eine KI-gestützte Empfehlung Schaden anrichtet? Soll ein Algorithmus über Prioritäten bei der Versorgung entscheiden dürfen?
Ethikberater:innen sind deshalb mehr denn je gefragt, um die Grenzen und den verantwortungsvollen Einsatz digitaler Technologien im Gesundheitswesen zu reflektieren. KI kann Daten liefern, aber nicht über Werte, Gerechtigkeit oder Menschenwürde urteilen. Das erfordert menschliche Abwägung, Empathie und moralische Verantwortung – Fähigkeiten, die sich nicht automatisieren lassen.
Fazit
Die hier vorgestellten Berufe zeigen, dass Zukunftssicherheit und gesellschaftliche Relevanz Hand in Hand gehen können. Ob in der Pflege, in der Bildung, im Umweltschutz, in der Stadtentwicklung oder in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit – diese Tätigkeiten sind geprägt von menschlichen Kompetenzen wie Empathie, Kreativität, Intuition und Kontextsensibilität. Sie lassen sich nicht vollständig durch KI ersetzen, weil sie Beziehungsarbeit, situatives Handeln und ethische Urteilsfähigkeit erfordern.
Gleichzeitig leisten Fachkräfte in diesen Berufen einen konkreten Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung, sozialer Gerechtigkeit und Gesundheit. In einer Welt, die zunehmend von technologischen Innovationen, Klimawandel und sozialen Umbrüchen geprägt ist, werden genau diese Fähigkeiten und Tätigkeiten unverzichtbar.
Zum Weiterlesen:
Wie wird sich KI auf unsere Arbeitswelt auswirken? Ein Ausblick auf die Zukunft der Nachhaltigkeitsbranche
So sehen soziale Berufe der Zukunft aus: Welche Jobs bald unverzichtbar werden